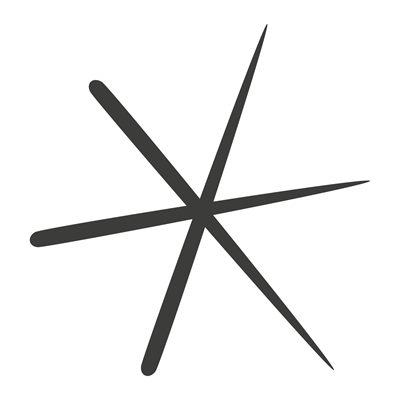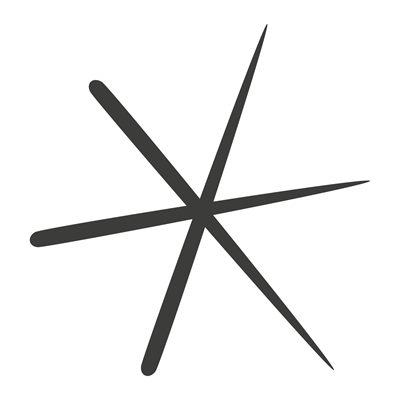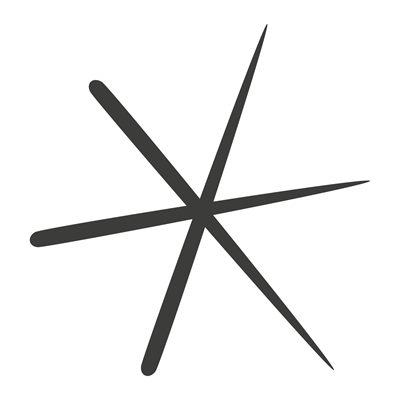13.12.2015
Sucre, die schöne Hauptstadt Boliviens, lassen wir hinter uns. Wir fahren weiter in die Salzwüste. Surreale Farben, kristallklarer Himmel und unser erster motorradtechnischer Zwischenfall sind einige der bleibenden Eindrücke dieser einzigartigen Region.
Doch bevor wir in die Salzwüste kommen, erreichen wir eine mittelgrosse Stadt Namens Potosi. Auf den ersten Blick eine ganz normale Minenstadt, wie wir sie schon etliche Male in Bolivien und auch in Peru passiert haben. Treffend heisst der Hausberg „Cerro Rico“, was „Reicher Gipfel“ bedeutet. Die Spanier haben in diesem Berg so viel Silber abgebaut, dass der Berg heute praktisch ausgehöhlt ist. Der Gipfel, momentan auf knapp 4‘800 m.ü.m. sinkt heute jedes Jahr um einige Zentimeter ein. Während den 300 Jahren spanischer Kolonialherrschaft starben in diesem Berg Schätzungen zu Folge 8 Millionen Menschen. Die versklavten Indios konnten nicht schnell genug ersetzt werden, so dass auch Sklaven aus Afrika in den Minen eingesetzt wurden. Auch heute arbeiten weiterhin etwa 15‘000 Bolivianer unter unvorstellbaren Bedingungen in diesem Berg. Der Hauptteil des Reichtums haben die Spanier aber mitgenommen, heute wird vorallem noch Zink abgebaut.
Die Mine gehört jetzt einer Genossenschaft der Arbeiter, was bedeutet, dass immerhin der Ertrag im Lande bleibt. Die Arbeitsbedingungen sind aber so ungesund, dass die Lebenserwartung der Männer auf 40 Jahre sinkt, man sagt, dass nach 10 Jahren in den staubigen Stollen noch 50% der Lunge Sauerstoff aufnehmen kann, dies wohlgemerkt in dieser ohnehin schon dünnen Luft. Die Mine kann man besichtigen, uns graut aber davor, uns in dieses Massengrab hinab zu begeben in dem noch heute so viele Menschen arbeiten, unbeeindruckt von der tragischen Vergangenheit und Gegenwart. „Der Berg, der Männer isst“ ist ein tragisches Beispiel eines Teufelskreises von Armut, schlechter Gesundheitsversorgung und Perspektivlosigkeit.
Auf guter Strasse fahren wir weiter in Richtung Uyuni, die Ausgangsstadt zum Besuch der „Salar de Uyuni“, der grössten Salzwüste der Welt. Am frühen Nachmittag sehen wir die Stadt, die den Witterungen zu trotzen scheint. Im Winter wird es hier bis zu -20°C kalt, auch jetzt, zu Beginn des Sommers geht ein starker Wind. Weit und breit nur karge Wüste, kein Baum, nicht mal ein Busch ist in Sichtweite und hinter der Stadt soweit das Auge reicht, die Salzwüste.
Erlaubt uns hier an dieser Stelle einen kurzen Exkurs zum Benzin in Bolivien. In diesen einsamen Gegenden ist ein genügender Vorrat natürlich immer ein Muss um sicherzustellen, dass man nicht irgendwo im Nichts mit Nichts dasteht. In Bolivien ist das Benzin stark subventioniert: Ein Liter kostet etwa 40 Rappen. Aber nur für die Bolivianer! Alle mit einem ausländischen Nummernschild bezahlen das Dreifache, etwa 1.20 Franken. Aber das ist hier nicht der Punkt. Diese Fremdensteuer wird mit einer speziellen Quittung verrechnet, die nur wenige Tankstellen und nur diejenige in grösseren Städte haben. Wollen wir die Reservekanister füllen, ist das nicht der Tank des Fahrzeuges, wir bezahlen den Preis der Bolivianer, die Tankstellenwärterin meint aber allen ernstes, dass wir die Differenz zum Touristenpreis ihr persönlich vermachen. Wir lehnen dankend ab. Das ist unser erstes Erlebnis an einer Bolivianischen Tankstelle. An der zweiten Tankstelle bekommen wir zwar eine Quittung, aber nur zu dem Preis, den die Bolivianer zahlen würden, die Differenz geht zweifellos in die eigene Tasche. Bei der dritten bezahlen wir so quasi den Durchschnitt, bekommen dafür natürlich keine Quittung. Was mit der Differenz passiert, dürft ihr drei Mal raten. Dazu kommt, dass das Benzin von so schlechter Qualität ist und wohl mit Wasser gepanscht, dass unser grünes Eselchen ständig am Bocken und am Husten ist. Das sind so einige der Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen, hier in diesem sonst so schönen Land Bolivien.
Vollgetankt, also Esel und Reiter, fahren wir von Uyuni noch eine kurze Strecke auf der Strasse in Richtung Norden, um dann links auf die Salzebene abzubiegen. An den meisten Stellen ist die Oberfläche hart und gut befahrbar. Spuren der Allradjeeps weisen den Weg und wir fahren guten Mutes in den Sonnenuntergang. Man sieht am Horizont mehrere Felsen, die wohl zu der Zeit, wo das ganze hier noch ein See war, Inseln bildeten. Dort wollen wir unser Zelt aufschlagen. Kein Problem, wir biegen einfach ab von der Spur und fahren auf eigene Faust zur nächsten solchen Insel. Plötzlich kommt Wasser: Normalerweise unerkennbar, da quasi in der obersten Salzschicht aufgelöst, spritzt es aber dann doch relativ heftig, als wir da rein fahren. Da der Untergrund aber immer noch hart ist, und wir uns vollends bewusst sind, dass wir nachher unser Motorrad waschen müssen, fahren wir weiter. Die Schuhe und das Motorrad werden mit einem schönen weissen Zuckerguss wie auf dem Lebkuchen überzogen. Die Oberfläche ist nicht immer glatt, die Kristallstruktur hat fünfeckige Waben über die ganze Ebene gezogen, die sind aber nicht wirklich hart und beim drüberfahren merkt man kaum etwas. Die Ränder der Waben werden aber immer grösser, so dass wir nur noch mit Schritttempo vorankommen. Die Distanz zur Insel ist schwer einzuschätzen, es gibt keine Anhaltspunkte. Aber auch diese Buckelpiste schaffen wir.
Dann geht es wieder ganz flott auf glatter Oberfläche weiter bis plötzlich das Hinterrad durch die Kruste bricht. Der unterdessen in aller Demut nicht mehr ganz unerfahrene Fahrer gibt automatisch Gas um wieder auf die Kruste zu kommen, vergebens. Wir stecken fest, das Hinterrad bis über die Achse im Salz und Schlamm eingelocht. Das Motorrad steht auch ohne Seitenständer. Von der Jeepspur sind schon über 15km abgebogen, von da ist also keine Hilfe zu erwarten. Wir nehmen alles Gepäck ab um das Gewicht zu reduzieren, hilft auch nichts. Erst durch starkes Anheben des Hinterrades kommt wieder Bewegung in die Sache und wir können unser nun weisses Eselchen auf sicheren Grund manövrieren. Die Beifahrerin muss zur noch etwa 2km weiten Insel laufen um das Gewicht zu reduzieren, das Hinterrad droht noch mehrmals einzubrechen, mit genug Schuss erreicht der Fahrer aber der sichere Schotter der Insel. Bei einem wunderschön blühenden Kaktus stellen wir das Zelt auf, essen noch ein wenig und verkriechen uns in unsere Casita. Als es komplett dunkel ist schauen wir nochmals kurz aus dem Zelt: Der Himmel wolkenlos, mondlos und keine Lichtverschmutzung weit und breit, der Sterne funkeln spektakulär! Die Sorge, wie wir uns am nächsten Tag wieder aus diesem Schlamassel herausmanövrieren werden, verschieben wir auf den nächsten Tag.
Nach einer angenehmen Nacht, packen wir alles zusammen. Wir haben bereits am Abend vorher mehrere Motorradspuren auf dem Schotter der Insel gesehen und wir entscheiden uns, diese zurück zu verfolgen. So umkreisen wir die Insel, die Spur wird breiter, problemlos erreichen wir eine befestigte Schotterpiste, die uns auch wieder zurück auf die Strasse und zurück nach Uyuni bringt.
Wir füllen nochmals den Tank, also Esel und Reiter, und fahren am frühen Nachmittag mit einem für nur sehr sehr sehr kurze Zeit sauberen Motorrad weiter auf der Route 21 in Richtung Tupiza. Route 21, erinnert ihr euch noch? Auf der Strasse mit der selben Nummer haben wir unsere schöne Transalp auch in Laos schon mal versenkt, hier der Link dazu. Wir sind uns bewusst, dass uns 200km Schotter erwartet, aber nicht wie schlecht die Strasse wirklich sein wird. Die unterschiedlichen Gesteinsarten werden durch das Gewicht der Lastwagen zu harten kleinen Buckeln vermengt. Mit dem Motorrad höchst unangenehm zu fahren weil alles zu Vibrieren beginnt. Schritttempo ist mancherorts die einzige mögliche Geschwindigkeit oder halt sogar auf die Wüste nebenan auszuweichen, was offensichtlich noch andere machen. So splittet sich die Strasse zu einem Netzwerk auf, und wir schlängeln uns durch. Wir schlucken Staub, viel Staub! Doch die Landschaft ist wunderschön. Wir fahren an einem Vulkan vorbei, durch Täler, Wüste mit sich abwechselnden Farben, kleine Dörfer und immer wieder neben riesigen Lama- und Schafherden.
Vorgesorgt haben wir Proviant und Wasser für mehrere Tage dabei. Wir stellen unser Zelt auf halber Distanz auf, 100km an einem Nachmittag, alles schmerzt. Am nächsten Tag wird die Strasse abschnittsweise etwas besser und wir erreichen am Mittag Tupiza und somit die Teerstrasse. Von dort aus ist es noch einen Katzensprung an die Grenze zu Argentinien. Doch zum bisher mühsamsten Grenzübergang wohl seit der Erfindung der Grenze überhaupt mehr im nächsten Bericht.
We leave Sucre, the beautiful capital of Bolivia, behind us. We continue to the salt desert. Surreal colors, crystal clear skies and a first small incident on a motorcycle are some of the lasting impressions of this unique region.
But before we get to the salt desert, we reach a medium-sized town called Potosi. At first glance, this is a completely normal mining town, as we have already passed several times in Bolivia and Peru. The local mountain is appropriately called "Cerro Rico", which means "rich summit". The Spanish mined so much silver in this mountain that the mountain is practically hollowed out today. The summit, currently at almost 4,800 meters above sea level. sinks a few centimeters every year. During the 300 years of Spanish colonial rule, an estimated 8 million people died in this mountain. The enslaved indigenous people could not be replaced quickly enough, so slaves from Africa were also used in these mines. Even today, around 15,000 Bolivians continue to work in this mountain under unimaginable conditions. The Spaniards took most of the wealth with them, and today only zinc is left to mine.
The mine is now owned by a workers' cooperative, which means that at least the yield remains in the country. But the working conditions are so unhealthy that the life expectancy of men drops to 40 years, it is said that after 10 years in the dusty tunnels, only 50% of the lungs can still absorb oxygen, mind you, in this already thin air. The mine can be visited, but we dread going down into this mass grave where so many people still work today, unimpressed by the tragic past and present. “The mountain that eats men” is a tragic example of a vicious circle of poverty, poor health care and a lack of prospects.
We continue on a good road towards Uyuni, the starting point for visiting the "Salar de Uyuni", the largest salt desert in the world. In the early afternoon we see the city that seems to defy the weather. In winter it gets down to -20°c here, even now, at the beginning of summer there is a strong wind. Far and wide only barren desert, not a tree, not even a bush is in sight and behind the city as far as the eye can see, the salt desert.
At this point, allow us some remarks on petrol in Bolivia. In these lonely areas, a sufficient supply is of course always a must to avoid bad surprises. In Bolivia, petrol is heavily subsidized: a liter costs around 40 cents. But only for the Bolivians! Everyone with a foreign license plate pays three times as much, around 1.20 francs. But that's not the point here. This tourist tax is offset against a special receipt that only a few petrol stations and only those in larger cities have. If we want to fill the reserve canister, which is not the tank of the vehicle, we pay the price of the Bolivians, but the gas station attendant seriously tries to convince us to pay difference to the tourist price to her personally. We decline. This is our first experience at a Bolivian gas station. At the second gas station we get a receipt, but only for the price the Bolivians would pay, the difference will undoubtedly go into their own pockets. With the third, we pay the average, of course we don't get a receipt for it. You can guess three times what happens to the difference. In addition, the gasoline is of such poor quality and probably mixed with water that our little green donkey is constantly bucking and coughing. These are some of the challenges that we have to face here in this otherwise beautiful country of Bolivia.
With a full tank of fuel, we drive a short distance from Uyuni on the road north, then turn left onto the salt flat. In most places the surface is hard and easy to drive on. Traces of the four-wheel drive jeeps show the way and we drive into the sunset in good spirits. We can see several rocks on the horizon, which probably formed islands at the time when everything was still a lake. We plan to pitch our tent there. No problem, we just turn off the track and drive to the next such island on our own. Suddenly there is water: normally undetectable, as it is practically dissolved in the topmost layer of salt, but then there is a sudden splash when we drive over it. Since the ground is still hard and we are fully aware that we have to wash our motorcycle afterwards anyway, we continue. The shoes and the motorcycle are covered with a nice white icing like a Christmas gingerbread. The surface is not always smooth, the crystal structure shows pentagonal honeycombs, but they are not really hard and we can drive over them without problems. But then, the edges of the honeycombs are getting bigger and bigger, so that we can only move forward at walking pace. The distance to the island is difficult to estimate, there are no clues.
We drive on the again very smooth surface until suddenly the rear wheel breaks through the crust. Simon automatically accelerates to make it back on the crust, in vain. We're stuck, the rear wheel sunk in the salt and mud up to the axle. The motorcycle stands without a side stand. It has been more than 15km already that we turned off the jeep lane, so no help is to be expected from there. We take off all the luggage in order to reduce the weight, nothing helps. Only when we raise the rear wheel with all the force we can muster, the matter moves again and we can maneuver our now white donkey on safe ground. Subsequently, Josephine has to walk the remaining way to the island, approximately 2km, in order to reduce the weight. The rear wheel threatens to break in again several times, but with enough speed Simon reaches the safe gravel of the island. Next to a beautiful blooming cactus we set up the tent, eat a little dinner and then retreat into our «casita». When it is completely dark we take a quick look out of the tent again: The sky is cloudless, moonless and no light pollution is to be seen far and wide, the stars are sparkling spectacularly! We are postponing the worry of how we will maneuver our way out of this mess until the next day.
After a pleasant night, we pack everything together. We saw several motorcycle tracks on the gravel of the island the night before and we decide to follow them back. So we circle the island, the track becomes wider, we easily reach a paved gravel road that brings us back to the road and back to Uyuni.
We fill the tank again, and in the early afternoon we continue on route 21 in the direction of Tupiza with a motorcycle that has been clean for only a very, very short time. Route 21, do you remember? On the road with the same number we had our jungle adventure in Laos, here is the link. We are aware that 200km of gravel awaits us, but not how bad the road will really be. The weight of the trucks mixes the different types of rock into hard, small bumps. It is very uncomfortable to ride the motorcycle because everything starts to vibrate. Walking pace is the only possible speed in some places, sometimes it is even better to drive next to the actual road in the sand. The road splits into a network and we meander through. We swallow dust, a lot of dust! But the landscape is beautiful. We drive past a volcano, through valleys, through the desert with alternating colors, small villages and again and again next to huge herds of llama and sheep.
We have prepared provisions and water for several days. Therefore we can pitch our tent halfway, after 100km in one afternoon, everything hurts. The next day the road gets a bit better in sections and we reach Tupiza and thus the tar road at noon. From there it is just a short hop to the border with Argentina. About the most arduous border crossing so far we will tell you next time.